
Wie gelingt Net Zero im unternehmerischen Alltag?
Im Juni fand in Neumünster zum nunmehr vierten Mal das Energiewende-Event "Industry meets Renewables" statt. In den Vorträgen ging es um ganz konkrete Ansätze, die bereits umgesetzt oder initiiert wurden. Ein zentrales Thema: Wie gelingt die Realisierung von Net Zero im unternehmerischen Alltag? Und welche Lehren können andere Betriebe – nicht zuletzt Hidden Champions – daraus ziehen?
Die Veranstalter des Kongresses, darunter Watt 2.0, bieten mit dem Format regelmäßig die Möglichkeit, mit Expertinnen und Experten über die Herausforderungen und Potenziale der Energiewende zu sprechen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Dieses Mal unter anderem dabei: Tobias Goldschmidt, Energiewendeminister des Landes Schleswig-Holstein und Schirmherr der Veranstaltung, sowie Joshka Knuth, Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur. Im Fokus des Programms standen Themen wie Dekarbonisierung, nachhaltiges Wirtschaften und Versorgungssicherheit. Praxisnahe Vorträge verschiedener Betriebe gaben Einblicke in laufende Transformationsprozesse.
Die Hidden Champions Redaktion stellt die Beiträge von drei Unternehmen vor, die sich auf den Weg Richtung Net Zero gemacht und über Maßnahmen, Erfolge und Herausforderungen berichtet haben. Net Zero bedeutet, dass die Menge an Treibhausgasen, die in die Atmosphäre freigesetzt wird, durch Maßnahmen zur Reduktion und Entfernung von Emissionen ausgeglichen wird, sodass kein Nettoanstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre erfolgt.
 Krones AG
Krones AGJens Lücke, Experte für Klimamanagement bei Krones, wo Emissionen weitgehend reduziert werden.
1. Net-Zero im Maschinen- und Anlagenbau – die Strategie der Krones AG
Die Krones AG, Hersteller von Abfüll- und Verpackungslösungen mit Konzernzentrale in Neutraubling, verfolgt das Ziel, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. „Wir sprechen nicht von einer Nachhaltigkeitsstrategie, sondern von einer Unternehmensstrategie, die nachhaltig ist“, stellte Jens Lücke, Klimamanager des Unternehmens, gleich zu Beginn klar.
Besonders emissionsintensiv seien bei Krones die thermischen Prozesse im Feld, etwa bei der Flaschenreinigung oder Pasteurisierung. Doch auch die eigene Wärmeversorgung spielt Lücke zufolge eine zentrale Rolle. „Intern ist die Heizung der größte Hebel. Da setzen wir auf Wärmepumpen, Solarthermie und saisonale Speicherlösungen.“ Am Hauptstandort werde derzeit eine großflächige Solarthermieanlage installiert, die über den Sommer einen 5.000-m³-Wasserspeicher auflädt. Im Winter werde die gespeicherte Wärme sukzessive genutzt – unterstützt durch einen Hackschnitzelkessel.
Am Standort Ungarn wiederum wird laut Lücke statt der Nutzung einer Grundwasserpumpe ein vergleichbares System mit Erdsonden betrieben. Zudem wurden Maschinen – etwa Tunnelpasteure – so weiterentwickelt, dass sie an Wärmepumpen angebunden werden können und intern erzeugte Prozesswärme rückführen. So lasse sich der fossile Energieeinsatz auch im Betrieb beim Kunden deutlich reduzieren.
CO₂-Emissionen der eigenen Standorte bereits mehr als halbiert
Der Blick richtet sich Lücke zufolge zunehmend auf Scope-3-Emissionen. Das sind jene indirekten Emissionen, die durch vor- und nachgelagerte Aktivitäten entstehen. Das Engagement der Krones AG reicht hier von der Dekarbonisierung der Stromnetze, auf die der Betrieb angewiesen ist, bis hin zu grünem Stahl in der Lieferkette. Das Unternehmen berichtet seine Klimadaten wie bereits in den letzten Jahren nach CSRD-Standards und lässt sie von seinem Wirtschaftsprüfer prüfen. „Wenn man sich Ziele setzt, muss man auch wissen, wo man steht“, betonte Lücke. Die CO₂-Emissionen der eigenen Standorte seien gegenüber dem Basisjahr bereits mehr als halbiert worden.

Encentive-Mitgründer und CEO Torge Lahrsen stellte Flexon vor – eine KI-gestützte Energiemanagement-Plattform.
2. KI-basierte Energiesteuerung: Volatile Strompreise als Chance nutzen
Bei der Dekarbonisierung spielt längst auch Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Wie sich KI im Energiemanagement wirtschaftlich nutzen lässt, zeigte Torge Lahrsen von der Encentive GmbH am Beispiel von Ornua Foods Deutschland. Das Unternehmen, bekannt durch die Marke Kerrygold, produziert Butterprodukte, die sowohl Kühlung als auch Prozesswärme benötigen. Um auf Schwankungen im Strommarkt möglichst optimal reagieren und die Volatilität gewinnbringend nutzen zu können, entwickelte Encentive die KI-gestützte Plattform Flexon, die Prozesse vorausschauend steuern soll. Grundlage ist ein sogenannter Closed-Loop-Ansatz: Es werden Daten von Sensoren an Kühlanlagen und Elektroboilern ausgelesen, Prognosen für Energiebedarfe erstellt und unter anderem Energiepreise abgerufen. So werden optimierte Sollwerte an die Systeme zurückgegeben, auf die eine automatisierte Umsetzung folgt.
Das System kühlt etwa das Kühlhaus in günstigen Stunden stärker herunter („Pre-Cooling“) und senkt so die elektrische Last während teurer Phasen. Für teure Phasen werde also ein Puffer aufgebaut, von dem gezehrt werden kann, ohne dass neuer Strom in der Kälteanlage verbraucht werden muss.
Win-Win: Emissionen senken und Energiekosten sparen
An einem Beispieltag im März habe der Strompreis in der Spitze bei rund 180 Euro/MWh gelegen, sei zur Mittagszeit auf unter 20 Euro gefallen und anschließend wieder gestiegen. Das System reagierte gezielt: In den frühen Morgenstunden und am Mittag sei die Kälte vorproduziert und im Kühlhaus zwischengespeichert worden, sodass beide Preisspitzen umgangen werden konnten.
Ein ähnliches Vorgehen sei für die Wärmeerzeugung umgesetzt worden: Ein Elektroboiler schalte sich automatisiert zu, sobald die strombasierten Wärmeentstehungskosten unter denen der Gasversorgung liegen. So könne der gasbasierte Wärmeerzeuger temporär ersetzt werden. „Wir konnten nicht nur Energiekosten sparen, sondern gleichzeitig die CO2-Emissionen senken“, resümierte Lahrsen mit Blick auf die Effekte bei Ornua.
Die Lösung soll perspektivisch auf unterschiedliche industrielle Szenarien übertragbar sein und dazu beitragen, eine ganzheitliche Optimierungsstrategie am Standort umzusetzen. „Themen sind zum Beispiel E-Lkw, genauso wie Flurförderzeuge und ähnliche Anlagen, die dann Stück für Stück integriert werden", erklärte Lahrsen.

„Es braucht unternehmerischen Mut“, erklärte Bernd Heesch, Mitglied der Geschäftsführung der Spedition F. A. Kruse jun., während seines Vortrags zum klimaneutralen Transport.
3. E-Mobilität in der Spedition – mit E-Lkw und Eigenstrom
Bernd Heesch, Mitglied der Geschäftsführung bei der Spedition Friedrich A. Kruse jun., präsentierte den herausfordernden Weg zur klimaneutralen Logistik – konkret durch den Einsatz von E-Lkw in Kombination mit eigener Solarstromproduktion. Im April 2024 konnte erstmals eine eigene Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort in Betrieb genommen werden.
Heeschs Ausführungen machten die Dimension des Projekts greifbar: Die Stromversorgung erfolge größtenteils über eine neue Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1,5 MW. Um das Vorhaben zu realisieren, sei die Planung eines eigenen Mittelspannungsnetzes notwendig gewesen sowie ein Anlagenzertifikat, die Teilnahme an der EEG-Ausschreibung und Direktvermarktung. Damit der Eigenverbrauch sichergestellt ist, musste Heesch zufolge verhindert werden, dass Solarstrom über öffentliche Leitungen geleitet wird. Darüber hinaus sei der Bau zweier neuer Trafostationen im Abstand von nur 500 m erforderlich gewesen. „Zwei wirkliche Kostentreiber, die nicht vermieden werden konnten“, wie Bernd Heesch berichtete.
Um den Eigenverbrauch weiter zu optimieren, soll derzeit ein Lastmanagementsystem für die Ladeinfrastruktur implementiert werden. Auch die Anschaffung eines Batteriespeichers sowie eines weiteren Fahrzeugs inklusive Ladesäule werde geprüft. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 3,5 Millionen Euro, abzüglich der erhaltenen Fördermittel. Trotz der Komplexität dieser Vorgehensweise spricht sich Heesch – auf Nachfrage aus dem Publikum – gegen eine Ladung per Oberleitung aus: Der Aufwand für den Ausbau der Infrastruktur sei enorm.
Mitentscheidend: die richtigen Umsetzungspartner
Heesch betonte, dass solche Projekte mehr erfordern als nur Technik und Kapital: „Es braucht unternehmerischen Mut, einen sehr hohen eigenen Kümmeraufwand – und willige Partner, die mitziehen.“ In der Praxis sei die Digitalisierung oft eine zusätzliche Hürde: „Digitalisierung bedeutet: keine Ansprechpartner mehr, nur noch Portale, in denen man sich zurechtfinden muss.“ Die zunehmende Komplexität der Förderanträge, Ausschreibungen und Schnittstellen führe schnell zur Überforderung – bei Personen wie bei Systemen. Umso wichtiger sei es, die richtigen Partner zu finden – und dranzubleiben. „In unserem Fall waren es beispielsweise die örtlichen Stadtwerke“, so Heesch.
Fazit und Ausblick
Die Vorträge zeigten, wie Net-Zero-Strategien wirtschaftlich umgesetzt werden können – mit Mut, technologischem Know-how und klaren Daten. Über die beschriebenen Praxisbeispiele hinaus bot das Programm zahlreiche weitere Impulse. So etwa einen Bericht zum Einsatz von Batteriespeichern, eine Präsentation möglicher Dekarbonisierungswege in der Behälterglasherstellung sowie einen Vortrag zur CO2-Reduktion im Flughafenbetrieb. Start-ups präsentierten ihre Strategien in kompakten Pitches.
Die nächste Gelegenheit zum Austausch in diesem Format bietet sich voraussichtlich am 10. Juni 2026 – wieder in Neumünster.
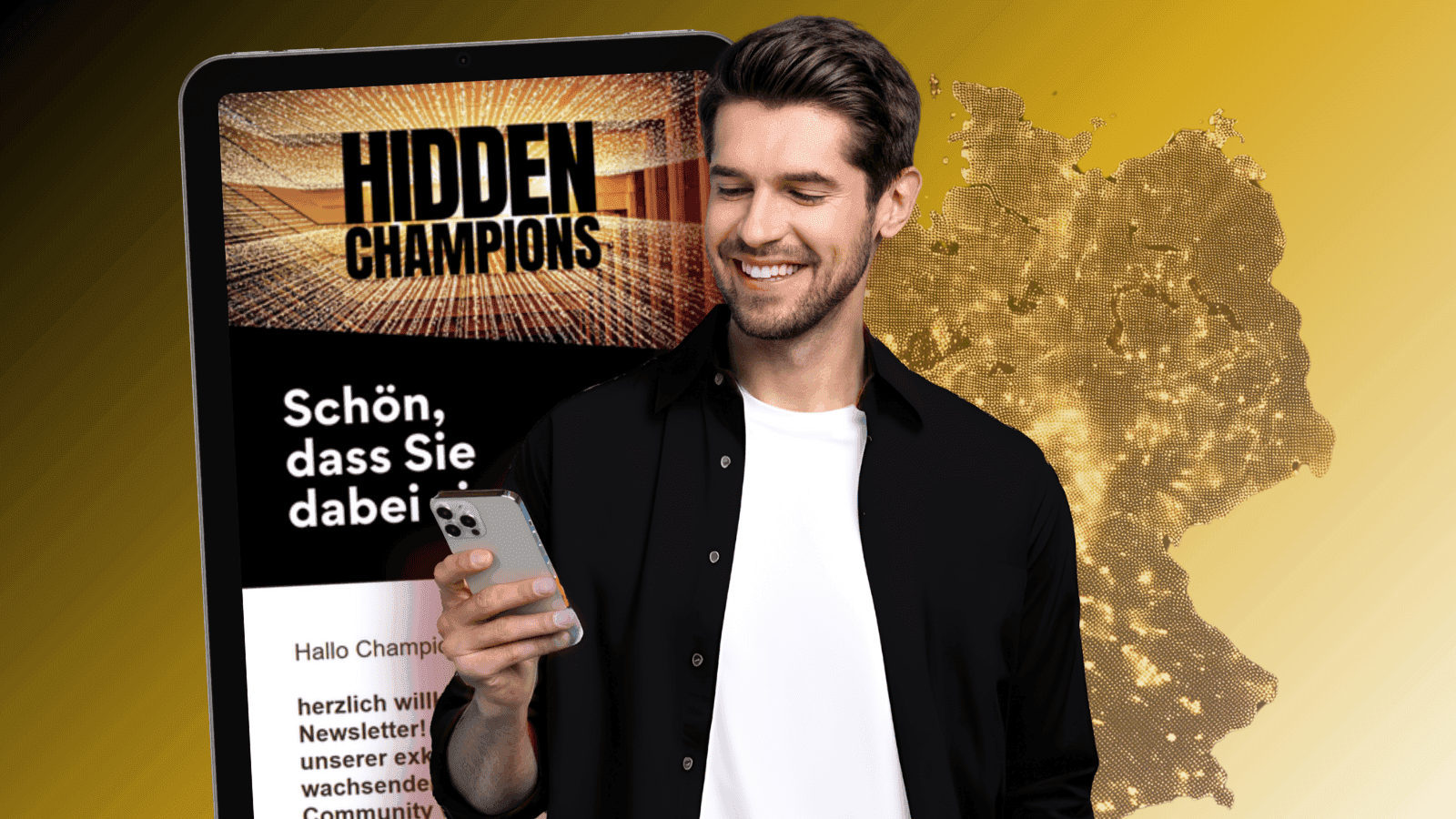
Jetzt für den Newsletter anmelden
Bleibe auf dem aktuellen Stand zu den Hidden Champions

Hidden Champions in Deutschland
Unsere Karte zeigt, wo Innovation und weltweiter Erfolg auch abseits der Metropolen stattfindet.

Hidden Champion hinzufügen
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie einen Hidden Champion kennen und dieser bisher nicht bei uns aufgelistet ist.





